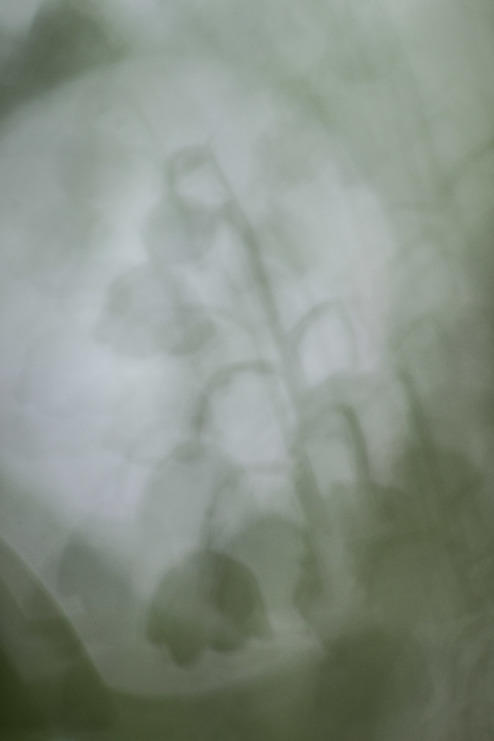Fotogedanken
… persönliche Anmerkungen zur Fotografie
Inspirationen aus der Malerei

Kornblumen am Weyerberg bei Worpswede. Das Dorf im Norden von Bremen ist eine der bekanntesten Künstlerkolonien Deutschlands. Ich bin oft hier und lasse mich bei Besuchen der zahlreichen Museen und Galerien inspirieren.
Als die Fotografie Mitte des 19. Jahrhunderts rasch an Popularität gewann, prophezeiten nicht wenige vermeintliche Experten ein Ende der Malerei. Und tatsächlich mag vielen, die ihren Lebensunterhalt mit gemalten Porträts oder Postkartenansichten verdienten, in der Folge die Kundschaft verloren gegangen sein (wenn sie nicht selbst ein Foto-Atelier eröffneten). Grundsätzlich aber verdrängte die Fotografie die Malerei vor allem in den Bereichen, in denen es um handwerklich solides und präzises Abbilden von Dingen oder Personen ging. Wo immer die kreative und damit zwangsläufig subjektive Auseinandersetzung mit Motiven wie Personen, Landschaften, Pflanzen oder Gegenständen im Vordergrund stand und steht, hat sich die Malerei als eine Form der bildenden Kunst behauptet. Und neben ihr die Fotografie.
Es zeigte sich in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder, dass sich künstlerische Malerei und künstlerische Fotografie in vielfältiger Weise befruchten. Maler nutzen fotografische Techniken um Vorlagen zu erstellen, als »Bildernotizbuch« – und die Fotografie machte es aus Sicht vieler Künstler überflüssig, Dinge möglichst naturgetreu wiederzugeben, weil das die fotografischen Verfahren ohnehin viel besser konnten. Fotografie beflügelte so also die Entwicklung abstrakter Bildauffassungen in der Malerei.
Andererseits kann jeder Fotograf vom Umgang mit Licht und Perspektive von den Großen der Malerei lernen und nicht erst seit kurzem versuchen Fotografen durch unterschiedliche Techniken ihren Bildern einen malerischen Charakter zu verleihen. Diverse Wischeffekte, Mehrfachbelichtungen, gezieltes Defokussieren, die Verwendung alter, sich durch spezifische »Macken« auszeichnender Objektive, die Rückbesinnung auf alte »analoge« Techniken sind nur einige Beispiele für eine eher »malerische« Fotografie.
Deutlich wird aus dem Gesagten hoffentlich, dass es auch für Fotografen überaus sinnvoll und hilfreich ist, sich mit anderen Formen bildnerischer Kunst auseinanderzusetzen, über Tellerränder hinwegzusehen.
Natur als Nebendarstellerin?

Arche de Port Blanc an der Côte Sauvage nahe Quiberon in der Bretagne. Ich mag Landschaften gerne pur. In meiner Fotografie spielen sie die Hauptrolle. Menschen sind daher, wenn sie überhaupt im Bild zu sehen sind, in der Regel klein abgebildet, geben in erster Linie einen Eindruck von den Größenverhältnissen.
Die »sozialen Medien« haben mittlerweile einen beträchtlichen Einfluss auf die Fotografie. Namentlich Plattformen wie Instagram bringen nicht nur neue »Stars« der Fotografie hervor, sie beeinflussen auch in vieler Hinsicht Bildsprache, Sehweisen und Konsumverhalten.
Natürlich gab es auch früher schon vereinzelt die vorlauten Selbstdarsteller, die mit ihren Diashows durch die Lande tingelten, dann anstelle der im Programm angekündigten Länder vor allem sich, ihre Lebensgefährtin oder ihr Auto vor mehr oder minder attraktiver Kulisse zeigten – und sich so selbst zum Hauptthema machten. Ich fand das, von wenigen Ausnahmen abgesehen, zumeist peinlich, denn mich interessierte eigentlich, wie der Fotograf das jeweilige Land sah und in Bildern erfasste – und weniger wie er tatsächliche oder vermeintliche Gefahren meisterte um sich dann als mutiger Held zu präsentieren.
Wie gesagt – das war früher. Klickt man sich heute durch den Instagram- oder Facebook-Feed, stellt man fest, dass diese Art der Selbstdarstellung längst Mainstream ist. Landschaftsfotos ohne irgendeinen kernigen Abenteurer-Darsteller an prominenter Stelle im Bild sind mittlerweile fast schon die Ausnahme. Erhabene Landschaften verkommen zur Staffage, zur Bühne für selbstverliebte Hedonisten. Besonders spektakuläre Bilder locken Massen an die jeweiligen Orte. Die Nachahmer haben dann vor allem ein Ziel: sich in genau der selben Weise zu inszenieren, um am Ende möglichst viele »Likes« zu generieren. Ob die Natur an den betroffenen Orten zerstört wird – total egal.
Die erfolgreichsten Selfie-Landschaftsfotografen, die es zuweilen vermögen, Tausende Anhänger hinter sich zu scharen, nennen sich dann »Influencer« – Beeinflusser – und werden mit etwas Glück von finanzkräftigen Werbeabteilungen renommierter Firmen hofiert. Mit großem Eifer werben sie dann für die jeweiligen Produkte, preisen – zum Beispiel – die überragenden Qualitäten von bestimmten Kameras, Objektiven, Stativen, Filtern oder Rucksäcken an und lassen sich auch gerne mal in Nebensätzen über die ach so mäßige Qualität von Konkurrenzprodukten aus. Ich find’s gruselig, dass sich in Zeiten von »Fake News« und »alternativen Fakten«offenbar nicht wenige gerne von solchen Pseudo-Informationen beeinflussen lassen. Vielleicht werde ich aber einfach auch nur alt…
Zahmes Deutschland…
… trotzdem schön!
Schon seit einiger Zeit ist ein Trend zum „Wilden“ wahrzunehmen. In Büchern, Magazinen und Fernsehsendungen werden die vermeintlich wilden Aspekte unserer Heimat gezeigt. „Wildes Deutschland, Wildes Sachsen, Wildes Bayern – und demnächst vielleicht Wildes Dortmund oder Wildes Hamm?“ Ziemlich fauler Zauber, finde ich angesichts meiner fotografischen Erfahrungen, die ich in vielen Jahren in deutschen Landschaften zwischen Ostsee und Bodensee sammeln konnte. Wild und unberührt ist hierzulande so gut wie nichts mehr, aber dennoch oder gerade deshalb hat unsere zahme, kultivierte und industrialisierte Landschaft ihren Reiz. Ohne menschlichen Einfluss wäre der überwiegende Teil des Landes schließlich bewaldet und damit recht einförmig. Erst die jungsteinzeitlichen Bauern und Viehzüchter leiteten hier gravierende Veränderungen ein, sorgten durch Kultivierung der Landschaft für erhebliche Abwechslung, schufen mit Weiden, Wiesen und durch Beweidung in Wäldern neue Lebensräume und legten so auch die Grundlage für den heutigen Artenreichtum. Später prägten Obst- und Weinbau viele Regionen. Und mit der Industrialisierung ab dem 19. Jahrhundert folgten ein weitere, freilich unter ökologischen Gesichtspunkten keineswegs nur positiv zu bewertende menschliche Eingriffe in das Landschaftsbild. Fotografisch gibt es in alten wie in neuen Kultur- und Industrielandschaften viel Spannendes, Irritierendes, Schönes oder – selten – Bedrohliches zu entdecken. Langweilig aber wird es nie!
Fototherapie
Fotografieren gegen Stress
Wir leben in einem ziemlich komplizierten Zeitalter. Bilder und andere Informationen strömen aus den unterschiedlichsten Kanälen auf uns ein: Fernsehen, Radio, Tageszeitungen, Wochenmagazine und die enorme Vielfalt der Möglichkeiten, sich Wissen oder Halbwissen über das Internet anzueignen, erwecken zwiespältige Gefühle. Immer wieder ertappe ich mich dabei, mal hier, mal da im Internet zu klicken, durch Fernsehmagazine zu zappen oder Artikel in Zeitschriften nur zu überfliegen. In der Flut wird es schwer, das wirklich Wichtige zu erkennen. Auch in anderen Bereichen wird uns viel abverlangt: Meist kryptische Bedienungsanleitungen von Kaffeemaschine, Mikrowelle, Anrufbeantworter, MP3-Player, Handy und der neuesten Text- oder Bildverarbeitungssoftware wollen entschlüsselt werden, weil die immer komplizierter und mit immer mehr Funktionen überladenen Geräte und Programme ansonsten kaum das tun, was sie sollen. Digitale Kameras und die entsprechende Peripherie fügen sich nahtlos in dieses Szenario ein. Unterm Strich fehlt uns an allen Ecken und Enden Zeit. Zeit wird zum immer knapperen, immer wertvolleren Gut. Viele sehen sich in einem immer schneller drehenden Strudel aus Zeitnot, Stress und Anspannung. So geht es auch mir immer wieder und ich entdeckte dabei schon vor längerer Zeit, welchen therapeutischen Effekt die Fotografie haben kann – vorausgesetzt man schafft es, sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren: das Finden von Motiven und das Gestalten von Bildern über die Wahl des Ausschnittes, der Zeit und der Blende und zwar am besten mit einer ganz, ganz einfachen Ausrüstung. Natürlich klaut die neue Technik nicht nur Zeit, sie bringt auch Vorteile, die man nutzen soll oder sogar muss. Ab und an aber ist es sinnvoll, zu entschleunigen, sich auf etwas Bestimmtes zu konzentrieren und das nagende Gefühl, ständig etwas zu verpassen oder die Angst in vielen Bereichen nicht mehr auf dem neuesten Stand zu sein, zu verdrängen. Meine Medizin ist da oft eine richtig große, schwere, gänzlich unautomatische Mamiya RB67, mit der sich Rollfilm im Format 6 x 7 cm belichten lässt. Aber ganz egal für welches Werkzeug man sich letztendlich entscheidet, Fotografie bietet die Option, sich über die Konzentration auf Motive aus dem Stress des Alltags auszuklinken – Meditation auf etwas andere Art. Mir hilft’s und ich bin sicher, vielen anderen auch.
Subjektiv – nicht objektiv
Fotografie zeigt interpretierte Realität
Vor ein paar Tagen habe ich mir in einer stillen Stunde mal wieder eines der alten Lehrbücher von Ansel Adams aus dem Regal genommen. Adams gilt vielen als einer der herausragenden Landschaftsfotografen des 20. Jahrhunderts. Seine Fotografie hatte erheblichen Einfluss auf die Entwicklung des Naturschutzes in den USA. Die grandiosen Schwarzweißbilder unter anderem aus dem Yosemite-Nationalpark vermitteln starke Emotionen und wie nur wenige verstand es Ansel Adams, eigene Empfindungen über das subtile Spiel von Tonwerten und Graustufen anschaulich zu machen. Der Aufwand den er dazu im Fotolabor betrieb, war beträchtlich und die Beschreibung der einzelnen Bearbeitungsschritte, bis hin zum fertig ausgearbeiteten Fotoabzug füllen beispielsweise in seinem Buch „Das Positiv“ nicht selten eine ganze Buchseite. Da wurde mehrfach partiell abgewedelt, größere und manchmal winzige Bilddetails nachbelichtet. Er tat alles in seiner Macht stehende, um die Wirkung des Bildes seinen Vorstellungen gemäß zu optimieren, um dem Betrachter so möglichst viel von der Dramatik einer Situation spüren zu lassen. Mit Dokumentation im engeren, vermeintlich objektiven Sinne hatte das wenig zu tun. Nicht Realität, sondern subjektiver, vom individuellen Empfinden bestimmte Subjektivität ist daher Gegenstand der Aufnahmen. Gleichwohl gilt Ansel Adams auch heute noch vielen Naturfotografen – zu Recht – als leuchtendes Vorbild und viele wandeln auf seinen Spuren und mit seinen Bildern im Kopf durch die großen amerikanischen Nationalparks. Einige davon sind dennoch schnell dabei, wenn es darum geht, moderne, sprich digitale, Techniken der Kontrastbewältigung und Bildbearbeitung als Manipulation oder gar als Betrug am Betrachter zu verdammen. Ich bin aber sicher, dass gerade Ansel Adams von den Möglichkeiten, welche die digitale Dunkelkammer bietet, begeistert gewesen wäre. Insbesondere die verschiedenen Methoden, die es gestatten, nahezu beliebig hohe Kontraste in einem Foto abzubilden, wie etwa HDR, hätten ihm so manche Stunde mühsamer Bastelarbeit im Labor erspart. Naturfotografie die etwas bewirken, die für die Sache begeistern möchte, funktioniert letztendlich nur, wenn es gelingt, beim Betrachter Emotionen zu wecken und dazu bedarf es eben mehr als eines so genannten „Fotodokuments“, welches – technisch unzulänglich in Szene gesetzt – einfach nur zeigt, wie es am betreffenden Ort aussieht. Dem Umgang mit Licht und Kontrasten kommt in diesem Zusammenhang – besonders in der Landschaftsfotografie – eine entscheidende Bedeutung zu.
Wo und wie entsteht ein Bild?
Spontane Eingebung versus gezielte Planung
Wo und wie entsteht ein Bild? „Wirklich gute Bilder entstehen zuerst im Kopf!“ – Das werden Ihnen viele Fotografen im Brustton der Überzeugung erzählen. Aber ist das tatsächlich so – immer? Ich habe mir in letzter Zeit häufig Gedanken darüber gemacht, wie fotografische Bilder entstehen – nicht im technischen Sinne, das heißt durchs Objektiv auf den Sensor oder Film projiziert und dann in irgendeiner Weise fixiert. Nein, inhaltlich, gestalterisch, ästhetisch …
Natürlich klingt das erst mal eindrucksvoll, wenn man für sein Bild in Anspruch nimmt, es vorab visualisiert zu haben. Ausgehend von einer Idee die Umsetzung plant und dann am Ende das Resultat präsentieren kann. Fraglos gibt es viele Bilder, die genauso entstanden sind und in manchen Bereichen – etwa der professionellen Werbe-, Food- und Modefotografie – ist das sogar die Regel. Auch Naturfotografen planen zuweilen Aufnahmen akribisch, betreiben einen immensen Aufwand, bauen Verstecke, schaffen Futter heran, betätigen sich als Bühnenbildner, warten stunden- oder sogar tagelang, bis tierische Modelle kooperieren – oder auch nicht.
Und dann gibt es da noch diese ganz andere Art an Bilder zu gelangen – spontan und ungeplant, einfach so. Man geht raus, streift mit offenen Augen durch die Natur und lässt sich überraschen. Die Art der Bilder, die man auf solch einer „ergebnisoffenen“ Suche, in vielleicht sogar gänzlich unbekanntem Gelände, findet, hat viel mit der jeweiligen Stimmung zu tun, in der man gerade ist. Gut gelaunt neige ich zum Beispiel dazu, Dinge auszuprobieren, zu experimentieren, mit Farbe, Licht und Schärfe zu spielen. Dabei entstehen immer wieder Bilder, die mir gefallen oder es ergeben sich aus dem Experiment heraus wieder Ideen für weitere Versuche.
Blicke ich in mein Bildarchiv, so muss ich feststellen, dass der größere Teil meiner Lieblingsbilder auf diese unplanmäßige Weise entstanden ist und ich habe den Eindruck, dass diese eher spielerische Herangehensweise mir sehr dabei hilft, meine Art des fotografischen Ausdrucks weiter zu entwickeln. So finde ich, hat beides seine Berechtigung. Es wird immer Bilder geben, die zunächst im Kopf und dann irgendwann real genauso oder ähnlich entstehen. Aber ebenso muss in der kreativen Fotografie Platz für Spontaneität sein, für eine unvoreingenommen spielerische Annäherung an ein Thema. Weder der eine, noch der andere Weg garantiert gute Bilder, aber bei beiden Methoden sind sie möglich.
Fluch der Technik
Das Ergebnis zählt – nicht die Technik, mit dem es entstand

Morgen im Pilsholz | Hamm/Westf. Zur Info: Das Bild habe ich mit einer ziemlich betagten digitalen 8 MP-Kompaktkamera, einer Samsung Digimax Pro 815, gemacht.
Hobbys dienen gemeinhin dazu, sich zu entspannen, vom Arbeitsstress abzulenken, Abwechslung in ansonsten gleichförmige Alltage zu bringen, Neues kennen zu lernen, Kreativität auszuleben. Fotografie kann eine Freizeitbeschäftigung sein, die all das und vielleicht sogar ein bisschen mehr ermöglicht. Die Betonung allerdings liegt auf dem „kann“. Hört man sich in einschlägigen Amateur-Kreisen um, so erfährt man, dass viele gar nicht so entspannt mit ihrem Hobby umgehen. Da geht es um Termine für Wettbewerbe, die man nicht verpassen darf, um Erfolge, die man erzielen möchte, um Neid und Missgunst und um die Schwierigkeit, technisch immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Bis vor kurzem bereitete zudem der Wechsel von analog zu digital vielen schlaflose Nächte, heute ist es oft der Zweifel, ob die eigene Digitalkamera noch gut genug oder nach zwei, drei Jahren schon eher ein Fall fürs Museum ist: Soll ich oder soll ich nicht das neueste Modell kaufen? Was, wenn ich den Anschluss verpasse? Mit meinem alten Krempel kann ich doch keinen Blumentopf mehr gewinnen! Für nicht wenige, so scheint es, entsteht in der Freizeit mehr Stress als am Arbeitsplatz. Wie wäre es daher, mal einen Moment innezuhalten und darüber nachzudenken, was man sich damit eigentlich antut, um dann beherzt auf die Bremse zu treten. Digital oder analog, alte oder neue Kamera? – Egal, Hauptsache das Bild ist gut! Wettbewerb und Leistungsdruck? In Maßen hilfreich, aber muss man das in der Freizeit haben? Den Anschluss an die neueste technische Entwicklung verpassen? Technik ist zweitrangig, Sehen und Gestalten können dagegen entscheidend sein, und dabei ist es egal, ob Sie mit einer 50 Jahre alten Rollfilmkamera oder dem neuesten Megapixelwunder unterwegs sind.
Der Schmetterling im Kühlschrank
Auch kleine Tiere sollten ein Recht auf Unversehrtheit haben

Glasflügelfalter | Schmetterlingshaus im Maxipark Hamm, aufgenommen mit einem 2,8/24-70 mm bei offener Blende.
Warum um alles in der Welt setzen Fotografen Schmetterlinge und andere Insekten in den Kühlschrank, besprühen sie mit „Tau“ und drapieren sie anschließend – klamm und steifgefroren – wieder „fotogen“ auf Blüten? Was geht in Leuten vor, die mit Geländewagen durch Schilfgürtel walzen, um dann bequem aus dem Auto heraus Bilder von Rohrdommeln machen zu können? Was denken sich Fotografen, die sich über die mürben Sandsteinklippen Helgolands abseilen, mitten hinein in die sensible Kolonie der Tölpel, Lummen und Dreizehenmöwen? Man könnte die Auflistung beliebig fortsetzen und fände dennoch keine vernünftige Erklärung. Kein Naturfoto rechtfertigt einen Verstoß gegen Naturschutzvorschriften und was da immer wieder zu beobachten ist, kann man eigentlich nur mit Wut und verständnislosem Kopfschütteln quittieren. Wer seinen fotografischen Ehrgeiz auf dem Rücken lebender Motive auslebt und glaubt, die um den Hals hängende Profikamera sei die Rechtfertigung für hemmungslosen Naturfrevel, hat was falsch verstanden. Besonders schlimm wird es, wenn entsprechende Bilder mit wunderschönen Märchen über ihre Entstehung „verkauft“ werden, wie das leider auch immer wieder in unserer Lesergalerie geschieht. Bedauerlicherweise erkennen wir nicht immer, wenn geschummelt wurde. Es ist sicher nur eine winzige Minderheit, die meint, dem fotografischen Erfolg auf unredliche Weise auf die Sprünge helfen zu müssen – die aber beeinträchtigen den Ruf der Naturfotografen in der Öffentlichkeit in hohem Maße. Respekt vor und Liebe zur Natur, der Anspruch Naturschutz zu unterstützen und – warum auch nicht – sich künstlerisch mit Natur auseinanderzusetzen, sind die wichtigsten Beweggründe vieler Naturfotografen. Übersteigerter Ehrgeiz hat da glücklicherweise nur selten Platz. Natur ist zudem in der Regel so interessant und vielseitig, dass gute Bilder überall auch ohne die genannten Fehltritte möglich sind.
Anders fotografieren…
mit einer Lichtfeldkamera

Das Bild wurde mit der Lytro Illum aufgenommen. Leider wurde sowohl die Online-Galerie vom Netz genommen als auch die Produktion der Kamera selbst mittlerweile eingestellt. Schade.
Ich hatte einige Zeit die Gelegenheit mit einer so genannten Lichtfeldkamera zu fotgrafieren, genauer mit der Illum von Lytro. Das besondere an dieser Art von Fotografie ist, dass die Kamera nicht einfach nur zweidimensional die Tonwerte und Farben eines Motivs erfasst, sondern auch die Richtung aufzeichnet, aus der das Licht kommt. Das wiederum macht es möglich, mit Hilfe spezieller Software die Aufnahme im Nachhinein und bislang ungekannter Weise zu modifizieren. So kann man nicht nur die üblichen Parameter Farbe, Kontrast, Helligkeit und Rauschen beeinflussen, sondern auch die Schärfentiefe und die Lage der Schärfenebene. Ein wichtiger Teil des kreativen Aufnahmeprozesses kann so auf die Nachbearbeitung verschoben werden. Zudem kann man aus einer einzigenAufnahme entweder mehrere sehr unterschiedliche Bilde erzeugen – zum Beispiel eines mit ganz geringer Schärfentiefe und eines mit Schärfe über das gesamte Bild. Alternativ kann man auch so genannte "Lebende Bilder" erzeugen. Der Betrachter kann dann entweder selbts durch Mausklick am gewünschten Punkt Schärfe erzeugen oder man animiert das Bild, lässt filmartig die Schärfe durchs Bild laufen. Faszinierend! Noch ist die Kamera noch nicht sehr leistungsfähig. Die "2D-Auflösung" für Ausdrucke liegt bei rund 4 Megapixeln, allerdings sind die Bilder auch erst in zweiter Linie für den Ausdruck gedacht. Ihren besonderen Reiz entfalten sie erst bei der Präsentation auf einem Bildschirm, wenn sie zum "Leben erwachen". Auf lange Sicht aber könnte da eine wirklich interessante Entwicklung ihren Anfang genommen haben. Insbesondere in der Actionfotografie zeichnen sich da sehr spannende Möglichkeiten ab, wenn der Autofokus kein limitierender Faktor mehr ist. Wird dadurch aber die gesamte Fotografie umgekrempelt? Ich glaube nicht. Noch immer freuen wir uns über das klassische "2D-Bild" an der Wand im Buch, in einer Zeitschrift. Um das einzufangen bedarf es nicht unbedingt dieser neuen Technik. Entscheidend ist und bleibt die Kreativität des Fotografen – egal ob mit Lichtfeld- Spiegelreflex- oder Lochkamera. Wirksame "lebende Bilder" funktionieren hingegen nicht mit jedem Motiv. Sie bedürfen einer besonderen, gut überlegten Gestaltung unter Berücksichtigung von Border- und Hintergrund. Ein schlichtes, klares Porträt hingegen – von Menschen oder Tieren gewinnt nicht an Wirkung, wenn während dem Betrachten die Scärfe von der Nasenspitze auf die Ohren fährt. Lichtfeldfotografie ist eine sehr, sehr spannende Angelegenheit. Es macht Spaß mit der Kamera zu fotografieren und zu experimentieren, meines Erachtens ist sie aber nicht die alleinige Zukunft der Fotografie, sondern eine neue, interessante Facette.
Tierische Modelle ganz nah
Intensive Momente
Tiere mit der Kamera zu porträtieren, ist ein ebenso spannendes wie lohnendes Thema für ein fotografisches Projekt. Sieht man einmal von beiläufig geknipsten Bildern sowie von immer wieder möglichen, glücklichen Schnappschüssen ab, so erfordert es ein intensives Beschäftigen mit dem jeweiligen Gegenüber. Es verlangt, sich, so gut es geht, in die tierischen Modelle hineinzuversetzen, um so schließlich das in Bildern auszudrücken, was man für das Wesentliche des Porträtierten hält. Da die Frage, was wesentlich ist, letztendlich weitgehend Ergebnis der Interpretation des Fotografen bleibt, gilt für Tierporträts, was auch für Porträts von Menschen gilt: Gute Porträts verraten wenigstens ebenso viel über den Fotografierenden wie über den Fotografierten. Der Fotograf bestimmt, wann er den Auslöser betätigt und fängt so im Idealfall das Modell genau in dem Moment ein, in dem es der eigenen Vorstellung am nächsten kommt. Das ist mit menschlichen Modellen aufgrund der nicht vorhandenen Sprachbarriere allerdings mitunter einfacher zu realisieren. Tiere – egal ob in der Wildnis oder im Zoo – reagieren selten, wie wir es uns wünschen, weshalb neben dem Glücksfaktor der Geduld entscheidende Bedeutung zukommt.
Neu sehen
Mut zum Experiment
Was ist eigentlich Naturfotografie? Gibt es eine allgemein verbindliche Definition dafür oder entzieht sie sich aufgrund ihrer Vielgestaltigkeit nicht ohnehin jedem Versuch einer formelhaften Beschreibung? Letzteres trifft wohl eher zu, auch wenn gelegentlich Meinungen zu vernehmen sind, die einer streng dokumentarischen, möglichst objektiven Darstellung der natürlichen Umwelt, der Tiere und Pflanzen das Wort reden. Wie bezeichnet man aber dann Fotos, die dieser strengen Auffassung nicht gerecht werden und wer hat warum die Autorität, allgemein gültig gute von schlechter, richtige von falscher Naturfotografie zu trennen. „So kann man das doch nicht fotografieren …“, ist ein in diesem Zusammenhang öfter gehörter Ausspruch. Warum denn eigentlich nicht? Gibt es Vorschriften, wie man Tiere, Pflanzen, Landschaften ins Bild bzw. ins „rechte Licht“ setzen darf? Mir sind sie zumindest nicht bekannt und in Zeiten, in denen sich sogar Behörden zumindest darum bemühen, den Wildwuchs von Vorschriften und Verordnungen zu entrümpeln, besteht wenig Anlass, Vorschriften zum korrekten Fotografieren der Küchenschelle, des Seeadlers oder der Beutelmeise zu erlassen. Jeder fotografiere nach seiner Fasson und ebenso darf sich jeder sein persönliches Urteil über alle Bilder, die er sieht, erlauben. Niemand erwartet, dass jedem alles gefällt, aber wenn alle fotografisch demselben Schema folgten, würde die Fotografie sich allenfalls aufgrund wachsender fototechnischer Fortschritte entwickeln, in dem beispielsweise Motive fotografierbar werden, die zuvor ohne Autofokus, Bildstabilisator oder hochempfindlichem Sensor nicht fototografierbar waren. Kreative Experimente, persönliche, subjektive Auffassungen und Interpretationen der Natur würden nicht stattfinden und das wäre bedauerlich. Vielfalt macht das Leben spannend und das gilt auch oder sogar besonders für die potenziell kreative Auseinandersetzung mit dem Medium Fotografie. Toleranz für andere Auffassungen sind ebenso wichtig wie kontroverse aber konstruktive Diskussionen.
Fotografisch entschleunigen
Spielen mit dem Lensbaby
Wir leben in einem ziemlich komplizierten Zeitalter. Bilder und andere Informationen strömen aus den unterschiedlichsten Kanälen auf uns ein: Fernsehen, Radio, Tageszeitungen, Wochenmagazine und die enorme Vielfalt der Möglichkeiten, sich Wissen oder Halbwissen über das Internet anzueignen, erwecken zwiespältige Gefühle. Immer wieder ertappe ich mich dabei, mal hier, mal da im Internet zu klicken, durch Fernsehmagazine zu zappen oder Artikel in Zeitschriften nur zu überfliegen. In der Flut wird es schwer, das wirklich Wichtige zu erkennen. Auch in anderen Bereichen wird uns viel abverlangt: Meist kryptische Bedienungsanleitungen von Kaffeemaschine, Mikrowelle, Anrufbeantworter, MP3-Player, Smartphone und der neuesten Text- oder Bildbearbeitungssoftware wollen entschlüsselt werden, weil die immer komplizierter und mit immer mehr Funktionen überladenen Geräte und Programme ansonsten kaum das tun, was sie sollen. Digitale Kameras und die entsprechende Peripherie fügen sich nahtlos in dieses Szenario ein. Unterm Strich fehlt uns an allen Ecken und Enden Zeit. Diese wird zum immer knapperen, immer wertvolleren Gut. Viele sehen sich in einem immer schneller drehenden Strudel aus Zeitnot, Stress und Anspannung. Fotografie hat einen durchaus therapeutischen Effekt – vorausgesetzt man schafft es, sich wieder auf das Wesentliche zu konzentrieren: das Finden von Motiven und das Gestalten von Bildern über die Wahl des Ausschnittes, der Zeit und der Blende und zwar am besten mit einer ganz, ganz einfachen Ausrüstung. Natürlich klaut die neue Technik nicht nur Zeit, sie bringt auch Vorteile, die man nutzen soll oder sogar muss. Ab und an aber ist es sinnvoll, zu entschleunigen, sich auf etwas Bestimmtes zu konzentrieren und das nagende Gefühl, ständig etwas zu verpassen oder die Angst in vielen Bereichen nicht mehr auf dem neuesten Stand zu sein, zu verdrängen. Ein prima Werkzeug, um Fotografie mal wieder als das zu erfahren was sie jenseits des dokumentierenden Mediums sein kann – ein kreatives Ausdrucksmittel nämlich – ist für mich das Lensbaby, ein minimalistisches Objektiv mit interessanten Möglichkeiten. Ich benutze die mittlerweile fast schon antike, etwa 2004 erschienene Version dieses merkwürdigen „Objektivs“ und freue mich immer wieder an der ungewöhnlichen von Bild zu Bild variierenden und daher nicht reproduzierbaren Wirkung. Aber ganz egal ob Lensbaby oder Leica-Linse, Fotografie bietet die Option, sich über die Konzentration auf Motive aus dem Stress des Alltags auszuklinken – Meditation auf etwas andere Art. Mir hilft’s und ich bin sicher, vielen anderen auch.
Des Fotografen Gespür für Licht
Licht bestimmt die Stimmung
Licht in allen Facetten ist die wohl bedeutendste Zutat eines jeden Fotos, das Malen mit Licht daher die eigentliche Tätigkeit des Photo-Graphen. Die Qualität des Lichts erkennen zu können und die Fähigkeit, sie sich für die beabsichtigte Bildaussage zu Nutze zu machen, unterscheidet den guten vom weniger guten Fotografen. Wem das Gespür für Licht fehlt, der wird vielleicht verzweifelt um die halbe Welt reisen, immer im irrigen Glauben, dass die wirklich tollen Motive nur auf anderen Kontinenten zu finden sind. Aber ohne dieses Licht-Gespür bringt man auch aus Afrika, Asien oder Amerika meist, von einigen Glücksschüssen abgesehen, nur wenige wirklich eindrucksvolle Bilder mit nach Hause. Wer dagegen sensibel genug ist, Licht und seine erstaunlichen Wandlungen im Tages- und Jahreslauf zu erkennen, entdeckt auch in vermeintlich unspektakulären Landschaften Motive, die erstaunen, überraschen oder einfach nur gut gefallen.
Tiere hierzulande
Eine Herausforderung- meistens…
Nicht wenige Tierfotografen blicken neidvoll nach Nordamerika oder Ostafrika. Große, spektakuläre Säugetiere gibt es da. Ihre teilweise geringe Fluchtdistanz erlaubt auch mit weniger langen Brennweiten, vorzeigbare Fotos. Bei uns hingegen, im oft trüben, engen, zersiedelten Mitteleuropa ist man doch schon froh, wenn gelegentlich mal ein Reh auf einem Acker steht oder man im Frühjahr – jenseits der Reichweite selbst langer Teles – den Hasen bei der Hochzeit zuschauen kann. Ist man als Tierfotograf hierzulande also praktisch gezwungen auszuwandern? Natürlich nicht! Wer Säugetiere fotografieren möchte, findet hier höchst interessante Motive: Reh, Hirsch, Dachs, Gämse, Murmeltier, Steinbock, Fuchs, Steinmarder, Siebenschläfer, Hase, Kaninchen, Seehund, Kegelrobbe, Hausmaus und Wanderratte – die Liste ließe sich noch erheblich verlängern! Viele davon sind keineswegs selten, allerdings kostet es, sieht man einmal von den Helgoländer Robben ab, oft etwas mehr Mühe, sie zu finden, als in den großen afrikanischen Nationalparks. Dort sind Fotografen meist in mehr oder weniger großen Gruppen unterwegs, hierzulande ist Tierfotografie ein eher einsames Vergnügen, dazu sind die meisten Tiere einfach zu scheu. Auch gilt es, Störungen zu minimieren, um Konflikte mit Bauern und Jagdpächtern zu vermeiden. Gute Kontakte zu diesen aber sind oft unerlässlich, wenn es darum geht, Möglichkeiten für Bilder, insbesondere des jagdbaren Wildes, auszuloten. Wem es vor allem um das Fotografieren selbst geht, der findet auch in den zahlreichen Wildparks und -gehegen gute Gelegenheiten, heimische Säuger ins Bild zu setzen. Dass diese Art der Fotografie mitunter verpönt wird, ist nicht recht nachvollziehbar. Auch wenn die Tiere leichter zugänglich sind, als in freier Natur, so erfordert doch auch die Gehegefotografie ein erhebliches Maß an fotografischem Können, um vorzeigbare Bilder zu machen.
Ambulante Landschaftsfotografie …
Macht man gute Fotos "nebenbei"?

Buhnen am Ostseestrand bei Zingst/Mecklenburg-Vorpommern. Zur Verlängerung der Belichtungszeit habe ich hier einen Neutralgraufilter (ND 1,8) verwendet.
Macht man gute Fotos so nebenbei, sind gute Tierfotos irgendwie mehr wert als schöne Bilder von Landschaften oder gar Pflanzen? Komische Fragen stellt der da, mögen Sie denken, aber das Gegrüble hat einen Grund. Der Anruf eines NaturFoto-Lesers veranlasste mich zum Nachdenken. Wir sollen doch wieder mehr Tierfotos drucken, meinte er. Landschaften könne er sich auch in anderen Magazinen anschauen und die mache ja eh jeder doch so nebenbei – ist doch keine Kunst! Naja, dachte ich und erinnerte mich an ein Telefongespräch nur wenige Tage zuvor. NaturFoto, so ein anderer Leser, gefällt mir wirklich gut! Für meinen Geschmack aber dürfte Landschafts- und Makrofotografie durchaus einen viel höheren Stellenwert haben. Ich schaue mir zwar gerne gute Tierbilder an, so der Leser weiter, aber zur Naturfotografie zählen für mich halt auch Landschaften und kleine Details. Da steh ich nun als Redakteur und frage mich, ob beide von der gleichen Zeitschrift reden. Dabei sind die Anrufe durchaus repräsentativ und erreichen mich so oder ähnlich immer mal wieder. Jeder, dass kann man daraus lernen, nimmt ein Magazin abhängig von den jeweiligen Interessen anders war. Für mich ist das eine interessante Beobachtung. Konsequenzen kann man daraus allerdings kaum ziehen, außer der vielleicht, dass man es kaum jedem immer recht machen kann. Zurück zur eingangs gestellten Frage, ob man gute Fotos, insbesondere von Landschaften, „nebenbei“ machen kann, wie der erstzitierte Leser meinte. Das, da bin ich völlig sicher, kann man nicht! Ein gutes Foto erfordert eine erhebliche kreative Leistung dessen, der auf den Auslöser drückt. Von ein und demselben Motiv können daher schlechte Fotografen schlechte und gute Fotografen atemberaubende Bilder machen – egal ob das ein Tier, eine Pflanze oder eine Landschaft ist. Von guten Fotos – unabhängig vom Sujet – lassen sich kreative Fotografen immer inspirieren. Der Tierfotograf kann sich anhand von Landschaftsbildern mit der Wirkung von Licht auseinandersetzen, der Landschaftsfotograf kann mit Gewinn eine grafisch ansprechende Makrofotografie analysieren. Völlig themenunabhängig gilt, dass „nebenbei“ gemachte Bilder meist auch genauso aussehen.
Wie wertvoll ist ein Bild?
Es gibt nicht nur eine Antwort
Wie bemisst sich eigentlich der Wert eines Bildes? Nein, ich meine nicht den in Cent und Euro, sondern den nicht konkret bezifferbaren, ideellen Wert. Was macht ein Bild wertvoll? Ist es die Erinnerung, die man als Fotograf oder auch als Betrachter damit verbindet, sind es die Mühen und vielleicht Gefahren unter denen es entstanden ist, die den Wert steigern? Ist dann das vielleicht atemberaubend schöne Landschaftsfoto, welches ganz entspannt vom Hotelfenster oder vom Parkplatz aus gemacht wurde weniger wertvoll, als das vielleicht weniger spektakulär erscheinende Bild, welches in einem entlegenen Gebirgstal nach sechstündiger, schweißtreibender Wanderung entstand? Ist ein eindringliches Porträt eines Orang Utans, welches im Gehege aufgenommen wurde, weniger wert, als das weniger perfekte Bild eines freilebenden Affen im Dickicht des Regenwaldes? Ist die fotografische, die kreative und gestalterische Leistung des Fotografen weniger wichtig für den Wert eines Bildes als die physische? Es sind viele Fragen, die sich mir in diesem Zusammenhang stellen und keine lässt sich so einfach mit ja oder nein beantworten. Vielmehr gibt es jeweils mehrere, individuell unterschiedliche, gleichwohl aber richtige Antworten. Aus Sicht des Fotografen kann der persönlich zugeordnete Wert eines Bildes durchaus mit der physischen Anstrengung und den Erinnerungen korrelieren. Natürlich ist es immer etwas besonderes, Tiere in freier Wildbahn zu fotografieren, ihnen vielleicht sogar sehr nah zu sein, oder sie zumindest, wenn auch weit weg, so festzuhalten, dass sie hinterher auf dem Bild noch erkennbar sind. Das können durchaus gelungene Fotografien sein, die auch bei Betrachtern Staunen oder Begeisterung auslösen. Aber selbst, wenn das nicht der Fall ist, sind die Bilder für den Einzelnen oft von hohem Wert. Der unvoreingenommene Betrachter hingegen, der die Begleitumstände der Aufnahme nicht kennt, wird an ein Bild andere Maßstäbe anlegen. Für ihn ist ein Bild von Wert, das ihn anrührt, bewegt, vielleicht auch Erinnerungen weckt. Er weiß in der Regel ja nicht, wie das Bild entstand, ob einigermaßen entspannt oder gar unter Lebensgefahr. So lange man als Amateur vor allem aus Spaß an der Freude und aus Liebe zur Natur fotografiert, steht sicher die ganz individuelle Bewertung eines Bildes einschließlich der damit verbundenen Erinnerungen im Vordergrund und so soll das auch sein. Sobald man sich aber mit seinen Bildern in die Öffentlichkeit wagt, zum Beispiel im Rahmen von Wettbewerben oder wenn man seine Aufnahmen Verlagen oder Redaktionen anbietet, muss man zur Bewertung seiner Bilder auch in die Rolle des unwissenden Betrachters schlüpfen und versuchen, Emotionen auszublenden. Das freilich ist eine wirklich schwere Übung, denn Fotografie hat halt doch sehr viel mit Gefühl zu tun. Man muss dann unterscheiden zwischen der Bedeutung die ein Bild für einen selbst hat und der Relevanz für einen neutralen Betrachter.
Zauber des Lichts
Metamorphosen der Landschaft

Bauernhof im Sulzbachtal bei Lauterbach | Schwarzwald.
Um die Bewegung der Wolken zu zeigen, habe ich die Belichtungszeit mit einem Neutralgraufilter (ND 3,0) verlängert.
Egal was man wo fotografiert, immer spielt das Licht eine entscheidende Rolle im Zusammenhang mit der Wirkung des Bildes auf den Betrachter. Dabei ist es keineswegs die schiere Quantität, sondern in erster Linie die Qualität, sprich Farbe und Einfallswinkel, welche dem Licht und damit dem Bild seine Stimmung verleihen. Das Erkennen und gezielte Suchen bestimmter Lichtsituationen, die Fähigkeit, Lichtstimmungen durch situationsgerechte Steuerung der Belichtung, das heißt häufig durch Korrekturen der Belichtungsautomatik, einzufangen, sind daher wichtige Schlüsselqualifikationen eines guten Fotografen. Von besonderer Bedeutung ist dieses „Gespür für Licht“ zweifellos in der Landschaftsfotografie. Faszinierend ist es, die Metamorphose einer Landschaft im Verlauf eines klaren, sonnigen Tages, vom kühlen, dumpfen Licht vor Sonnenaufgang bis zur Blauen Stunde in der Abenddämmerung zu verfolgen. Besonders dramatisch sind die ersten und letzten Minuten eines Tages im Gebirge, wo steil aufragende Felswände als riesige Projektionsflächen frühes und spätes Licht intensiv reflektieren. Es ist dabei in erster Linie das Licht selbst, welches Landschaften – nicht nur im Gebirge – für kurze, unwiederbringliche Momente verzaubert. Spektakuläre Lichtstimmungen einzufangen hat dabei durchaus etwas mit Wahrscheinlichkeiten zu tun: Je öfter man draußen ist, um so größer wird die Chance, faszinierende Lichtstimmungen zu erleben. Das Erlebte so einzufangen, dass spätere Betrachter der Bilder es nachempfinden können, ist eine Kunst, die den guten vom weniger guten Fotografen unterscheidet.
Alles schon fotografiert
Jeder sieht anders

Blüte des Kriechenden Hahnenfuß – bei Hobbygärtnern ist diese Pflanze eher unbeliebt. Die Aufnahme entstand mit einem 100 mm-Makroobjektiv bei offener Blenden f/2. Eine Blüte des Blutroten Storchschnabels sorgt in der rechten Bildhälfte für einen zusätzlichen Farbakzent.
Scheinbar Bekanntes in spannende Bilder zu verwandeln, in Bilder, die den einen staunen lassen, den andern zu lautstarker Ablehnung provozieren, ist vielleicht eines der anspruchsvollsten Ziele moderner Fotografie im Allgemeinen und der Naturfotografie im Besonderen. „Alles ist doch schon tausendfach fotografiert worden, es gibt nichts mehr zu fotografieren“ – solche Aussagen hört man immer wieder und allein durch die penetrante Wiederholung werden sie auch nicht richtiger. Natürlich gibt es bereits Millionen Bilder von Löwen, Rehen, Orchideen, Seeadlern und vermutlich sogar von der unscheinbaren Schattenblume. Es gibt Bilder, die sich nahezu (aber nie ganz) gleichen, die das Tier, die Pflanze richtig belichtet, scharf und formatfüllend in Bestimmungsbuch-Qualität eingefangen haben – solche Bilder polarisieren nicht, aber sie verraten auch wenig über den Menschen, der sie gemacht hat. Bilder aber, die die Natur weniger dokumentarisch, denn als individuelle und höchst subjektive Interpretation zeigen, vermitteln, wie der Fotograf das Motiv sieht und empfindet. Solche Bilder sind nicht austauschbar, sie erlauben es, unverwechselbare Handschriften zu erkennen und in der kreativen Auseinandersetzung mit dem Motiv erschließt der Fotograf dem Betrachter neue Sehweisen. So kann auch das millionste Bild des Leberblümchens, des Maiglöckchens oder der Ringelnatter dem Betrachter Neues verraten.